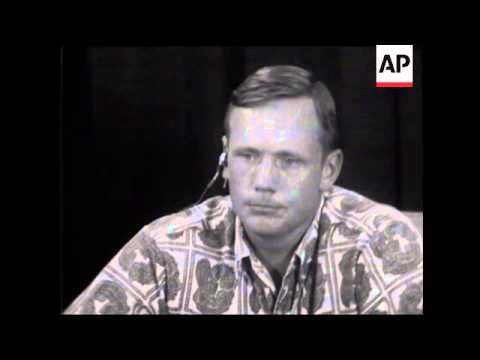To the Moon - Erfundene Geschichte über eine Lüge
Die Mondlandung von Apollo 11 hat wirklich stattgefunden. Es hat auch Produktkooperationen zwischen Firmen wie Omega oder Kellog’s mit der NASA gegeben. So gut wie alles andere in der von Apple produzierten Komödie To the Moon ist aber rein fiktiv und stellt weder das Mondprojekt, noch deren Beteiligten annähernd an die wahren Begebenheiten angelehnt dar. Als Romcom schlägt sich das ganz gut, auch weil der hohe Produktionsaufwand im Vergleich zu anderen Filmen dieses Genres ins Auge fällt. Dennoch zeigt sich Daniel irritiert, denn die Intention hinter dem hinzuerfundenen Kommerzfokus und anderen angedichteten Handlungssträngen in Verbindung mit einem wahren historischen Ereignis, löst sich nie ausreichend klar auf.
Daniel spoilert in diesem Podcast keine überraschenden Plot-Details, umschreibt den Gesamtverlauf der Rahmenhandlung aber, angemessen für eine Filmkritik, lose. Zumal es sich hier um eine fiktive Handlung im Rahmen wahrer, menschheitsgeschichtlich weitreichend bekannter Begebenheiten handelt.
Links & Videos zum Podcast
Wikipedia über Apollo 1 und die tödliche Katastrophe bei deren bemanntem Test
Daniels Artikel über First Man bzw. Aufbruch zum Mond bei Golem.de
Daniels Artikel über die eindrucksvolle Dokumentation Apollo 11 bei Golem.de
Die Letzte Filmkritik - Aufbruch zum Mond
Filmmenü-Podcast u.a. über die Dokumentation Apollo 11
Screenrant hat zusammengestellt, was und was nicht wirklich so war wie in To the Moon gezeigt
Business Insider darüber, wie viel wahres an To the Moon dran ist
Artikel über Kellog’s im Weltraum
Realität und Fiktion in Fly Me to the Moon
Historisch fundierte Elemente
Apollo-Programm und politischer Kontext: Der Film ist vor dem Hintergrund des Apollo-11-Projekts (Mondlandung 1969) angesiedelt, was ein reales historisches Ereignis ist. Er zeigt korrekt, dass die Mondlandung als Teil des Wettlaufs ins All im Kalten Krieg diente – die USA wollten die Sowjetunion im Space Race übertrumpfen und ihre technologische Überlegenheit demonstrieren. Auch der Hinweis im Film, dass das Apollo-Projekt positive Schlagzeilen liefern sollte, während im Vietnamkrieg immer mehr Unmut aufkam, entspricht der historischen Stimmung Ende der 1960er. Tatsächlich sah die US-Regierung die Mondlandung als wichtigen Propaganda-Erfolg, der intern wie extern moralisch Auftrieb gab.
NASA und Schauplätze (Kennedy Space Center): Fly Me to the Moon nutzt authentische Schauplätze der NASA. Große Teile wurden am Kennedy Space Center in Florida gedreht, wo Apollo 11 tatsächlich startete. Im Film sind originale Anlagen und Artefakte zu sehen, etwa die riesige Montagehalle Vehicle Assembly Building von 1966, die Saturn‑V-Mondrakete (eine von drei noch erhaltenen) und der historische „Astrovan“-Transporter der Astronauten.
Echte Apollo-Astronauten: Die Apollo-11-Besatzung – Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins – tritt im Film auf, dargestellt von Schauspielern. Diese Figuren basieren auf realen Personen und werden weitestgehend authentisch porträtiert. Allerdings bleiben die drei Astronauten in der Handlung Randfiguren; sie erscheinen in einigen Szenen prominent (als Stars des Mondlande-Projekts), stehen aber nicht im Zentrum der fiktiven Romcom-Geschichte. (Hinweis: Armstrongs berühmtes Zitat „Ein kleiner Schritt…“ wird im Film respektiert – es gibt jedoch keine Evidenz dafür, dass ihm dieser Ausspruch von PR-Leuten vorgeschrieben wurde).
Zeitgeschichtlicher Hintergrund (Vietnamkrieg & Öffentlichkeit): Der Film vermittelt, dass Ende der 60er Jahre die Begeisterung der US-Öffentlichkeit für das Raumfahrtprogramm zwischenzeitlich nachließ – u.a. wegen der steigenden Kriegsmüdigkeit im Vietnamkrieg und sozialer Unruhen. Dies stimmt mit historischen Tatsachen überein: 1968/69 stand die NASA unter dem Druck, trotz Protesten und Kostenbedenken die Bevölkerung für Apollo zu begeistern. Präsident Nixon (der 1969 ins Amt kam) und seine Regierung hofften tatsächlich, dass die Mondlandung patriotischen Stolz wecken und von negativen Schlagzeilen ablenken würde. Die Bedeutung der PR-Komponente von Apollo wird im Film also zutreffend angedeutet – der Propagandawert galt zeitgenössisch als enorm, teilweise sogar wichtiger als der wissenschaftliche Ertrag.
Product-Placement und Technologie: Einige im Film gezeigte PR-Taktiken haben reale Vorbilder. So lässt die fiktive PR-Managerin die Astronauten für Kellogg’s-Cornflakes werben und Omega-Uhren in die Kamera halten. Tatsächlich gingen NASA und Unternehmen solche Kooperationen in Ansätzen ein: Die Apollo-11-Crew nahm z.B. wirklich Kellogg’s-Flocken in spezieller Astronautenform mit ins All, und es gab Apollo-11-Editionen von Kellogg’s am Markt. Ebenso trugen die echten Astronauten offiziell die Omega-Speedmaster-Uhr – Omega vermarktete dieses Modell nach 1969 intensiv als „Moonwatch“. Allerdings inszenierte NASA keine direkten Werbespots mit den Astronauten während der Mission; solche überspitzten Product Placements im Film sind der künstlerischen Freiheit geschuldet. In der Realität musste NASA als Regierungsbehörde deutlich zurückhaltender agieren – Werbung mit staatlichen Programmen war rechtlich heikel. (So erwähnen Filmfiguren korrekt, dass NASA als staatliche Organisation eigentlich keine Reklame machen dürfe.) Die im Film gezeigte technische Ausrüstung – etwa die Saturn‑V-Rakete, das Apollo-Raumschiff und die Mondlandefähre – werden optisch detailgetreu nachgebildet. Auch die Herausforderung, ein Live-Fernsehbild von der Mondoberfläche zu senden, beruht auf Fakten: Apollo 11 übertrug die Mondlandung 1969 live im TV. Im Film wird dies dramatisch als Idee der PR-Strategin dargestellt, gegen die Ingenieure wegen des Gewichts der Kamera protestieren. Historisch gab es tatsächlich interne Debatten, da einige NASA-Ingenieure befürchteten, die Entwicklung einer Fernsehkamera könnte die Konzentration auf das eigentliche Landeziel stören. Doch hatten bereits vor Apollo 11 mehrere Missionen Kameras an Bord, und NASA entschied sich früh für TV-Bilder, weil die öffentliche Reichweite als strategisch wichtig galt.
Öffentlichkeitsarbeit der NASA: Die Grundprämisse – dass NASA professionelle Hilfe brauchte, um das öffentliche Interesse an Apollo 11 zu wecken – enthält einen wahren Kern. Tatsächlich engagierte NASA um 1969 externe PR-Berater und Kommunikationsspezialisten, als die Euphorie der Öffentlichkeit nachließ. So wurde z.B. eine PR-Agentur beauftragt, umfassende Informationsmaterialien zusammenzustellen: Legendär ist ein Ringbuch, das technische Details der Apollo-Missionen verständlich aufbereitete und an Medien verteilt wurde. Allerdings unterschied sich diese reale PR stark von der Filmhandlung: In Wirklichkeit ging es darum, sachliche Wissenschaftsinformation zu verbreiten und Bildungsarbeit zu leisten. Es gab keine einzelkämpferische PR-Guru-Figur mit Freibrief, wie Kelly Jones im Film – die NASA-Öffentlichkeitsarbeit war ein Team, das innerhalb offizieller Strukturen arbeitete. Kurz: Der Film greift den realen Umstand auf, dass Apollo auch vermarktet werden musste, überspitzt dies aber enorm und frei erfunden zu einer satirischen What-if-Story, in der PR-Tricks eine viel größere und untypischere Rolle spielen.
Fiktive bzw. satirische Elemente
Hauptfigur Kelly Jones (Scarlett Johansson): Die clevere Marketingexpertin und Trickbetrügerin – ist eine vollständig erfundene Figur ohne historisches Vorbild. Weder gab es 1969 eine junge PR-Managerin, die verdeckt fürs Weiße Haus arbeitete, noch irgendeine Mastermind in weiblicher Hauptrolle bei Apollo. Im Film wird Kelly mit überspitzter Biografie gezeigt (eine Betrügerin mit falscher Identität, die als PR-Ass Karriere machte), die speziell rekrutiert wird, um Apollo 11 in Szene zu setzen. Diese persönlichen Handlungsstränge – inklusive ihrer romantischen Verwicklung mit dem Projektleiter – sind reine Fiktion für die Komödienhandlung. In historischen Aufzeichnungen findet sich keinerlei Hinweis auf eine derartige Person; bereits im Vorfeld wurde klargestellt, dass Scarlett Johanssons Rolle keinerlei reale Basis hat.
Cole Davis (Channing Tatum) – fiktiver Projektleiter: Auch Cole Davis, der gutaussehende und prinzipientreue Startdirektor von Apollo 11, entstammt vollständig der Fantasie der Drehbuchautoren. Es gab zwar reale Flight Directors und Projektmanager (etwa Flight Director Gene Kranz oder Launch Operations Manager Rocco Petrone), aber keine entspricht direkt dieser Figur. Seine ablehnende Haltung gegenüber PR-Aktionen (Zitat: „Ich mache aus diesem Raumschiff keine fliegende Reklametafel!“) spiegelt die Sicht vieler Ingenieure wider, ist aber im Film bewusst überzeichnet, da es den dort dargestellten Konflikt im Team so niemals gab. Cole Davis dient vor allem als Gegenpol zu Kelly für die romantische Komödienhandlung; die entsprechend auch frei erfunden wurde.
Moe Berkus (Woody Harrelson): Der mysteriöse Regierungsagent, der Kelly anheuert, ist ebenfalls frei erfunden. Er wird als verdeckter Operateur „direkt im Auftrag des Präsidenten“ vorgestellt – in Wirklichkeit hat kein US-Präsident einen Geheimagenten geschickt, um PR-Leute für Apollo zu rekrutieren. Diese Figur karikiert eher populäre Konspirations-Motive (Men in Black-Klischees), indem angedeutet wird, dass im Hintergrund eine geheime Behörde die Fäden zieht. Moe erpresst Kelly mit ihrer kriminellen Vergangenheit, um sie für seine Mission gefügig zu machen – ein dramatischer Plotpunkt ohne historischen Anhalt. Zwar gab es im echten Apollo-Programm natürlich Absprachen zwischen NASA und Regierung in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, aber keinen dubiosen Einzelgänger wie Moe. Sein Charakter ist eine satirische Überhöhung, die Verschwörungstheorien parodiert (die Vorstellung, die Regierung habe im Geheimen wesentlich mehr inszeniert, als öffentlich bekannt). Interessant am Rande: Im Film arbeitet Moe für den „President-elect Nixon“, also den designierten Präsidenten Nixon Ende 1968. Nixon war real zwar im Januar 1969 für Apollo 11 zuständig, aber die Initiative zur Mondlandung ging auf JFK/Johnson zurück – der Film schreibt hier Nixon eine aktivere Rolle im PR-Manöver zu, was fiktive Dramaturgie ist.
Konflikt mit Politikern und Finanzierung: Die Episode, in der Kelly skeptische Senatoren von Apollo überzeugen muss, ist ahistorisch. Im Film begegnen ihr z.B. ein strenggläubiger Senator, der eine Mondlandung aus religiösen Gründen anzweifelt, und ein Haushalts-Hardliner, der kein Geld für die NASA locker machen will. Kelly gewinnt diese widerwilligen Politiker durch Charme und Manipulation für das Projekt, woraufhin “alle Geldhähne geöffnet” werden. Solche Szenen hat es nie gegeben. Zur Zeit von Apollo 11 war die Finanzierung bereits bewilligt und vom Kongress nicht akut infrage gestellt – das Mondlandeprogramm war politisch beschlossene Sache. Kein Senator stellte 1969 öffentlich die Wissenschaftsförderung in Frage, so wie im Film dargestellt. Die dramatische Bedrohung einer Budgetkürzung kurz vor dem Ziel ist ein rein dramaturgisches Element, um die Spannung zu steigern. Historisch waren die Budgetdebatten zwar spätestens in den 1970ern relevant (Apollo 18–20 wurden gekürzt), aber nicht unmittelbar vor Apollo 11.
PR-Aktionen im Film (Werbung, Schauspieler, Glamour): Fly Me to the Moon präsentiert eine Reihe überspitzter Marketingaktionen, die der Realität fern liegen. Beispielsweise engagiert Kelly Schauspieler, um langweilige NASA-Ingenieure für TV-Interviews zu ersetzen, komplett mit ausgedachten Lebensläufen, die spannender klingen. Natürlich hat NASA so etwas nie getan – in den 60ern traten echte Ingenieure und Wissenschaftler vor die Presse, auch wenn sie keine Entertainer waren. Ebenso überdreht ist die Darstellung, dass Apollo-Astronauten in jeder erdenklichen Werbung auftreten (von Cornflakes bis Uhren) und die Medienpräsenz wie bei Popstars gemanagt wird. In Wirklichkeit waren die Öffentlichkeitsarbeit und Berichterstattung viel nüchterner: Astronauten gaben Pressekonferenzen und es gab NASA-Dokumentationen, aber keine inszenierten Werbespots oder Imagefilme mit gecasteten „coolen“ Doppelgängern.
Gefälschte Mondlandungsaufnahmen (Verschwörungs-Spoof): Ein zentrales fiktives Element – und Höhepunkt der Satire – ist der Plan, eine Fake-Mondlandung zu drehen. Im Finale des Films organisiert Kelly in einer geheimen Hangarhalle ein komplettes Studio-Set der Mondoberfläche, um für alle Fälle eine inszenierte Mondlandung filmen zu können, sollte mit der echten Fernsehübertragung irgendetwas schief gehen. Laut Drehbuch erteilt Moe Berkus diesen Auftrag unter dem Codenamen „Project Artemis“, falls die echte Apollo-11-Mission scheitern sollte. Diese Plot-Idee ist frei erfunden und ganz klar durch reale Verschwörungstheorien inspiriert, die seit Jahrzehnten behaupten, die Mondlandung sei in Wahrheit in einem Studio inszeniert worden. Fly Me to the Moon spielt ausdrücklich auf die berühmteste dieser Theorien an – nämlich dass Regisseur Stanley Kubrick 1969 im Geheimen die TV-Bilder der Apollo-11-Landung gedreht haben soll. Der Film macht diesen Bezug deutlich: Kelly engagiert einen exzentrischen Filmregisseur (gespielt von Jim Rash), den sie scherzhaft „den Kubrick der Werbefilme“ nennt. Damit knüpft die Komödie humoristisch an die (widerlegte) Kubrick-Mondlandungs-Mythe an. Historisch belegt ist nichts dergleichen – es gab kein Backup-Filmteam für Apollo 11, und selbstverständlich wurden die Live-Bilder vom echten Mond gesendet. Die Einbeziehung dieses Themas im Film ist satirisch gemeint: Sie persifliert die Verschwörungsgerüchte, die rund um die Mondlandung kursieren, und treibt sie auf die Spitze, indem die Protagonisten selbst fast Opfer des eigenen Schwindels werden. (So ist im Showdown des Films kurz unklar, ob im Fernsehen gerade echtes oder gefälschtes Material läuft – bis eine Panne das Wahre enthüllt. Diese absurde Situation unterstreicht die Satire auf die Fake-Landing-Mythen.)
Verfremdete Abläufe und historische Ungenauigkeiten: Insgesamt entfernt sich der Film stark von den realen Abläufen der Apollo-Mission, um der Komödie Vorrang zu geben. Viele Dinge passieren im Film extrem kurzfristig oder chaotisch, was in Wirklichkeit undenkbar gewesen wäre. Beispiele: Die Einführung einer schweren Fernsehkamera „in letzter Minute“ kurz vor dem Start, weil PR das verlangt; oder interne Konflikte am Startplatz, weil PR-Termine die Ingenieure angeblich von der Arbeit ablenken. Solche dramaturgischen Zuspitzungen stehen in krassem Gegensatz zur tatsächlichen Präzision und Planungsstrenge der NASA. Fly Me to the Moon nutzt die 1960er-Jahre und das Apollo-Projekt nur als aufsehenerregende Kulisse (mit Zeitkolorit bei Kostümen, Technik und Musik) für eine fiktive Rom-Com, während Fakten flexibel behandelt alles nur wie Beiwerk ausschmücken. Wer den Film schaut, sollte also Realität und Fiktion klar trennen: Die Atmosphäre des Apollo-Zeitalters wird liebevoll nachempfunden, doch die Geschichte selbst und die meisten ihrer Figuren – von der PR-Liebeskomödie bis zur gefälschten Mondlandung – sind reine Fiktion mit nur sehr wenig Grundlage auf Basis der Realität.
(Text basierend auf ChatGPT-Auswertung und eigener Recherche von Filmkritiker Daniel Pook)
Feeds & Infos über die Podcaster
Alternativ zum Web-Player mit Download-Funktion kann Die Letzte Filmkritik direkt über diesen Link bequem bei iTunes abonniert werden. Wer per RSS-Reader oder sonstigen Podcatchern über neue Folgen informiert werden möchte, füttert sie mit diesem Link des XML-Feeds. Via Facebook, Youtube & Twitter bleibt ihr mit uns in Kontakt und auf dem Laufenden.
Dieser Podcast wurde von Daniel in unserem Studio in Berlin aufgenommen.